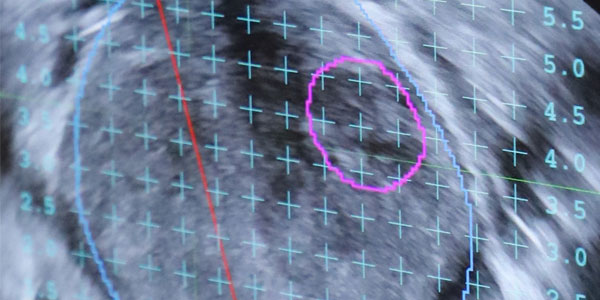Gefäßzentrum erneut zertifiziert
Kreis Göppingen. Das Gefäßzentrum der Alb-Fils-Kliniken ist als „Anerkanntes Gefäßzentrum“ rezertifiziert. „Das Zertifikat war ein schönes Vorweihnachtsgeschenk“, freut sich Dr. Marc Weigand, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Leiter des Gefäßzentrums, über die Zertifizierungsurkunde, die am 20. Dezember 2023 im Briefkasten lag. Ausgestellt wurde das Zertifikat von der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) und es bescheinigt dem Zentrum an der Klinik am Eichert eine sehr hohe Qualität bei der Behandlung von Patienten mit Gefäßerkrankungen. Um das Zertifikat zu erreichen, müssen strenge personelle, apparative und therapeutische Standards erfüllt werden. So müssen unter anderem eine Gefäßsprechstunde vorgehalten, eine 24/7-Versorgung durch Fachärzte für Gefäßchirurgie gewährleistet und eine hohe Fallzahl nachgewiesen werden. „Ganz wichtig ist auch eine funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit“, betont Chefarzt Weigand, „die wir hier zusammen mit den Experten der Inneren Medizin und der Radiologie intensiv leben.“
Die Erstzertifizierung des Gefäßzentrums liegt schon einige Jahre zurück. „Der frühere Chefarzt der Gefäßchirurgie, Dr. Peter Richter, hatte seinerzeit die erstmalige Zertifizierung initiiert, auf die wir nun gut aufbauen konnten“, sagt Lia Maren Blödorn vom Qualitätsmanagement der Klinik. Nach dem überraschenden Tod von Dr. Richter im Jahr 2018 war die Rezertifizierung zunächst zurückgestellt worden Die Alb-Fils-Kliniken gehören mit dieser Auszeichnung zu den rund 130 Krankenhäusern in Deutschland, die über ein Anerkanntes Gefäßzentrum verfügen. Das jetzige Zertifikat ist bis Ende 2026 gültig.
24.2.24